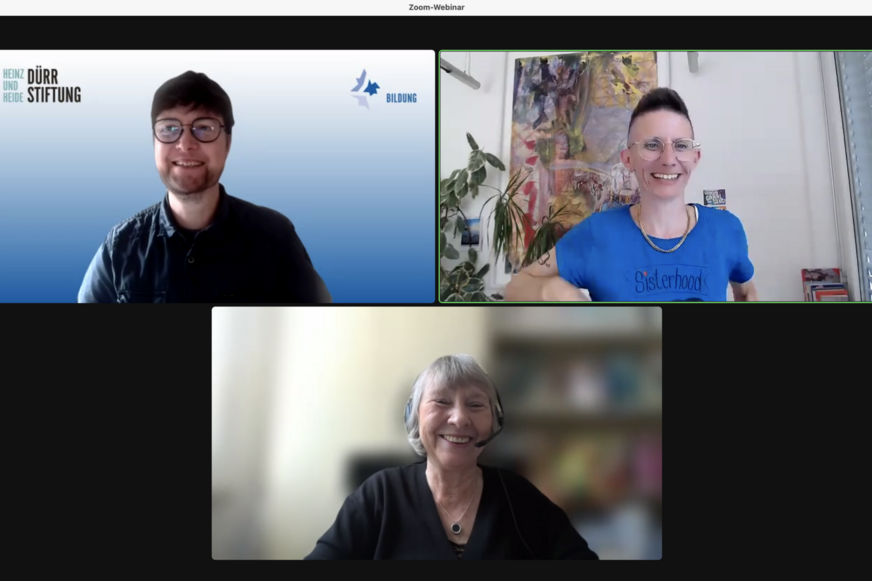Bisher stand die Online-Reihe „Wissenschaft meets Praxis“ ganz im Zeichen des pädagogischen und wissenschaftlichen Nachwuchses, indem Forschungsergebnisse von Promovendinnen im Rahmen dieser Vortragsreihe präsentiert wurden.
Mit Prof. Dr. Susanne Viernickel präsentierte erstmals eine Koryphäe der Elementarpädagogik ihre Forschungsergebnisse. Rund 70 teilnehmende Praktiker*innen folgten der beeindruckenden Präsentation aktueller Forschung, gepaart mit Leidenschaft und Engagement der Referentin, die für ein Qualitätsverständnis plädiert, das auf dem emotionalen Wohlbefinden junger Menschen basiert. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Punkte des Online-Vortrags zusammengefasst.
Nach Prof. Dr. Susanne Viernickel sind die ersten Lebensjahre junger Menschen durch eine herausfordernde Kombination gekennzeichnet: Einerseits sind die Kinder in den ersten Lebensjahren sehr verletzlich (hohe Vulnerabilität), andererseits machen sie gleichzeitig sehr schnelle Entwicklungsschritte. Qualität bemisst sich nach klassischen Modellen an der Begleitung dieser parallel ablaufenden Prozesse durch 1. strukturelle Rahmenbedingungen, 2. pädagogische Prozesse, 3. Partizipation, 4. Kinder als Akteur*innen, was aus Sicht von Prof. Dr. Susanne Viernickel Schwächen aufweist, da das Wohlbefinden der Kinder als Indikator für pädagogische Qualität dabei nicht ausreichend berücksichtigt werden würde.
Das Wohlbefinden des jungen Kindes zu erkennen und zu stärken, ist die Basis des EE-Konzepts. Susanne Viernickel hat in ihrem Vortrag einen eindrucksvollen systematisch-begrifflichen Zugang in dieses komplexe Themenfeld gegeben.
Annette Lepenies, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Heinz und Heide Dürr Stiftung
Anhand eines eindrücklichen Videobeispiels konnten sich die Teilnehmenden dieser Frage zunächst ganz intuitiv und beobachtend nähern. Ein Kind bewegt sich im Kita-Alltag barfuß auf einem Baum. Begleitet wird es von einer Erzieherin, die mit dem Kind kommuniziert. Ausgehend von diesen Szenen und dem Erleben der Zuschauenden stellte Prof. Dr. Susanne Viernickel im Anschluss an die ca. zweiminütige Video-Sequenz acht Facetten vor, anhand derer a) körperliches, b) seelisches/psychisches und c) soziales Wohlbefinden systematisiert werden kann:
- emotionaler Ausdruck (Körperliches Wohlbefinden)
- körperliche Zufriedenheit (Körperliches Wohlbefinden)
- Handlungskontrolle/Selbstwirksamkeit (Psychologisches Wohlbefinden)
- Selbstkonzept/Selbstwertgefühl (Psychologisches Wohlbefinden)
- Aktivierung von Bildungspotenzialen (Psychologisches Wohlbefinden)
- emotionale Sicherheit/Beziehungssicherheit (Soziales Wohlbefinden)
- emotionale Sicherheit im Kontakt mit Peers (Soziales Wohlbefinden)
- soziale Teilhabe und Beteiligung (Soziales Wohlbefinden)
Um kindliches Wohlbefinden in der frühen Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterstützen, müssen wir wissen, wie junge Kinder subjektiv Wohlbefinden erfahren/erleben.
Mashford-Scott et al., 2012, 231
Neben den Handlungsspielräumen, die das bio-psycho-soziale Modell des Wohlbefindens bietet, ist es nach Prof. Dr. Susanne Viernickel auch wichtig, die Dinge zu berücksichtigen, die ein Risiko für das Wohlbefinden von Kindern darstellen. In diesem Zusammenhang nannte die Referentin sechs Aspekte, die sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken können:
- individuelle Eigenschaften, z.B. Gesundheit, Kompetenzen, Temperament
- soziale Bedingungen, z.B. Gruppenkomposition, Peerbeziehungen, Partizipationskultur
- organisatorische Bedingungen, z.B. Gruppengröße, Betreuungsumfang
- räumlich-sachliche Bedingungen, z.B. Lautstärke, Spielmaterial
- Tagesablauf, z.B. unflexible Tagesstruktur, Zeitdruck in Mikro-Transitionen
- Umweltbedingungen, z.B. familiäre Situation, Eingewöhnung
In der Studie „Stimulation oder Stress? Der Einfluss von Gruppenkonzepten auf Kinder in Kindertageseinrichtungen“ wurde deutlich, dass Kinder mit erhöhtem Risiko ein geringeres Wohlbefinden zeigen als Kinder mit geringem Risiko. Deshalb ist es laut Prof. Dr. Susanne Viernickel so wichtig die Risikofelder so zu gestalten, dass das Wohlbefinden der Kinder wenig beeinträchtigt wird.
Der „Circle of Wellbeing“ ist eine Methode, Risiken zu erkennen und dadurch Wohlbefinden zu steigern.
Sehen (Beobachten) < Verstehen (Auswerten) < Handeln (Ressourcen nutzen, Risiken minimieren) < Prüfen (Evaluation)
Circle of Wellbeing
Die meisten der Anwesenden gehören dem Early Excellence-Netzwerk an und so war dies die erste Frage, die in der abschließenden Fragerunde gestellt wurde: „Wie schätzen Sie dass Early Excellence-Beobachtungsverfahren im Hinblick auf Wohlbefinden ein?“ Prof. Dr. Susanne Viernickel erläuterte kurz, dass der Beobachtungsbogen auch im Hinblick auf die Einschätzung des Wohlbefindens derzeit weiterentwickelt und geprüft wird. Early Excellence-Koordinator*in Sasha Saumweber ergänzte abschließend, dass die Heinz und Heide Dürr Stiftung sehr froh sei, neben Prof. Dr. Michael Lichtblau nun auch Prof. Dr. Susanne Viernickel in diesem großen Revisionsprojekt an ihrer Seite zu wissen.
Wir fühlen uns sehr bestätigt, in der Überarbeitung des Verfahrens noch mehr Augenmerk auf die Basic Needs von Kindern zu legen als bisher. In diesem Sinne sind wir sehr gespannt, was unsere Piloteinrichtungen bezüglich der Anwendung berichten.
Sasha Saumweber, Koordination & Fachberatung Early Excellence
Neuigkeiten dazu wird die Heinz und Heide Dürr Stiftung regelmäßig auf der Homepage und über verschiedene Veranstaltungen und Formate veröffentlichen. Alle Vorträge sind im YouTube-Kanal der Heinz und Heide Dürr Stiftung zu sehen.